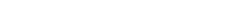„Newsletter-Update“ – worüber haben wir schon berichtet?

Judith Herzig
Neues zur Darlegungslast beim Schaden nach Art. 82 DSGVO
In unserem Newsletter Juli 2024 berichteten wir über die Rechtsprechung des EuGH zum Schadensersatz bei Verstoß gegen die Auskunftspflicht nach Art. 15 DSGVO. Grundsätzlich kann bei unterbliebener oder verspäteter Auskunft bereits der bloße Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten einen Schadensersatzanspruch der betroffenen Person auslösen. Allein der Verstoß gegen Art. 15 DSGVO reicht allerdings nicht aus. Vielmehr muss die betroffene Person konkret darlegen, inwiefern ein Kontrollverlust zu befürchten war oder eingetreten ist. Nunmehr hat sich auch das Bundesarbeitsgericht in zwei Entscheidungen mit dieser Thematik befasst (BAG v. 20.6.2024 – 8 AZR 91/22 und 8 AZR 124/23). Auch nach dem BAG ist unter Anwendung eines objektiven Maßstabs zu prüfen, ob die vorgetragene Befürchtung eines Daten- bzw. Kontrollverlusts nach den konkreten Umständen als begründet angesehen werden kann. Dabei sei u.a. die objektive Bestimmung des Missbrauchsrisikos der Daten von Bedeutung. Zudem stellte das BAG klar, dass allein die Befürchtung weiterer Verstöße gegen die DSGVO nicht für die Annahme eines Schadens ausreicht. Damit werden – zugunsten des datenverarbeitenden Arbeitgebers – strengere Anforderungen an die Darlegung eines konkreten Schadens gestellt.
Neues auch zur Erschütterung des Beweiswertes der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Mit Urteilen vom 21.8.2024 (5 AZR 248/23) und 18.9.2024 (5 AZR 29/24) befasste sich das Bundesarbeitsgericht erneut mit dem Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Diese schließen an die Judikatur zur Erschütterung des Beweiswertes in ähnlich gelagerten Fällen an, über die wir in unserem Newsletter Oktober 2024 berichteten. Hiernach kann der Arbeitgeber den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttern, wenn er ernsthafte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit darlegt, etwa durch zeitliche Koinzidenz zwischen Kündigung und Arbeitsunfähigkeit. In den jüngst vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fällen ist dies dem Arbeitgeber jeweils gelungen. Das BAG stellte insbesondere fest, dass Kündigung und Krankmeldung nicht zwingend zeitgleich erfolgen müssen. So ließ es in einem Fall genügen, dass die Krankmeldung zwar vor Ausspruch der Eigenkündigung des Arbeitnehmers erfolgt war, dessen Kündigungsentschluss aber nachweisbar bereits länger feststand. Im anderen Fall reichte es aus, dass der Arbeitnehmer nach Ausspruch der Eigenkündigung nach Dienstschluss am Freitag die Krankmeldung erst am nächsten Arbeitstag am Montag einreichte. Auch dürften nach dem BAG keine erhöhten Anforderungen an den Vortrag des Arbeitgebers gestellt werden. Vielmehr könne das Zusammentreffen ungewöhnlicher Umstände – insbesondere Widersprüche zwischen dem gerichtlichem Vorbringen des Arbeitnehmers und dem ärztlichen Attest oder ungewöhnliche Formulierungen im Kündigungsschreiben – in der Gesamtschau ernsthafte Zweifel am Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung begründen.
Zuletzt noch ein Hinweis zum Wachstumschancengesetz
Auf das anstehende Wachstumschancengesetz hatten wir im Newsletter Januar 2024 hingewiesen, dieses ist im März 2024 in Kraft getreten. Hieraus hat sich eine Änderung bei der sog. Fünftelregelung ergeben – einer Regelung, die Abfindungszahlungen steuerrechtlich begünstigt. Ab dem Jahr 2025 wird die Fünftelregelung erst im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers durch das zuständige Finanzamt angewendet und ist nicht mehr durch die Arbeitgeber im Lohnsteuerabzugsverfahren zu berücksichtigen. Eine „Abschaffung“ der Fünftelregelung ist damit nicht erfolgt, jedoch entlastet die Änderung die Arbeitgeber vom Prüfungs- und Berechnungsaufwand, der mit der vorgelagerten Berücksichtigung verbunden war. Bei künftigen Abfindungszahlungen ist daher darauf zu achten, dass die neue Rechtslage bei der Abrechnung berücksichtigt wird.